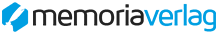Es gibt genau ein Datum im Jahr an dem man nicht geboren werden möchte. Unter keinen Umständen. Mich hat es erwischt. Und doch war dieser Zufall gleichzeitig ein Segen. Der 20. April war der Geburtstag des deutschen Reichskanzlers der Nazizeit und die ursprüngliche Idee meines Vaters Lukas, mich Adolf zu nennen, verflüchtete sich in dem Moment, als ich vier Jahre nach Kriegsende auf einem Bergbauernhof im österreichischen Obermillstatt das Licht der Welt erblickte. Mir am Geburtstag von Hitler den selben Vornamen zu verpassen – undenkbar! Meine Mutter Berta war niedergeschlagen, verurteilte sie die Geschehnisse der NS-Zeit doch aufs Schärfste. Die Schrecken des Krieges waren noch immer sichtbar. Das Reichsarbeitsdienstlager sollte erst 1977 einer Volkshochschule weichen. In dem Lager hausten kriegsgefangene Männer und Frauen wie Hunde, wenn sie nicht für die Bauern auf den Feldern ackern mussten. Auf uns Kinder übte dieser Bunker nach dem Kriegsende eine gewisse Faszination aus. Wir hoben die schweren Betondeckel an und rannten durch die unterirdischen Gänge. Ein Kriegerdenkmal erinnert bis heute an die 66 gefallenen Männer Obermillstatts. Fast jede Familie hatte Opfer zu beklagen.
Die Kriegserlebnisse meines Vaters
Mein Vater Lukas wurde im Munsterlager in der Lüneburger Heide stationiert. 1943 wartete er am Bahnhof auf den Abtransport nach Russland – dem schlimmsten aller möglichen Einsatzorte. Kurz bevor der Zug einrollte, wurde er über Lautsprecher ausgerufen. Ein Unteroffizier überbrachte ihm die Nachricht, dass er vor zwei Tagen Vater eines kleinen Jungen geworden sei. Hans war sein dritter Sohn. Aus Dankbarkeit, dem deutschen Volke in Kriegszeiten diesen Dienst erwiesen zu haben, wurde ihm der Russlandeinsatz erspart. Sie schickten ihn auf den Balkan.
Nur sehr selten gewährte uns Vater viele Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsgebiet einen Einblick in sein Seelenleben. Eine Geschichte werde ich niemals vergessen. In Serbien war er für den Postdienst eingeteilt. Sie fuhren immer zu zweit mit einem Wagen zur Poststation in ein nahe gelegenes Dorf. Da er noch an einer Maschine herumbastelte, beauftragte er seinen jungen Kollegen im Winter 1943, ausnahmsweise alleine zu fahren. Als dieser nach einigen Stunden nicht ins Lager zurückgekehrt war, schloss sich Lukas einem Suchtrupp an. Sie wurden schnell fündig. Der Mann hing an einem Baum, bestialisch zerstückelt, die Augen ausgestochen. Nach diesem Vorfall stellten Soldaten der SA und SS wieder die Ordnung in den Dörfern her, wie sie es nannten, was mein Vater mit den Worten „ekelhaft“ und „unvorstellbar“ kommentierte. Ein abscheulicher Racheakt. Im Herbst 1944 flüchtete er mit einigen Leidgenossen zu Fuß und mit dem Zug in die Heimat nach Kärnten. Für die wenigen Waffen, die sie noch besaßen, fehlte Munition und sie drohten zu verhungern. Beim Kommandanten in Spittal wurde er des Kriegsverbrechens der Fahnenflucht angeklagt, durfte aber auf den Hof zurückkehren. Beim Verhör einige Wochen später spielte ihm die erneute Schwangerschaft meiner Mutter in die Karten. Er wurde nicht wieder zum Militärdienst eingezogen.

Das wunderschöne Ambiente war bei der harten Feldmaloche für Rudi (r.) nur ein schwacher Trost
Zwischen Peitsche und Freiheit
Das Erlebte hatte ihn hart gemacht. Das traf vor allem uns Kinder. Die Birkenrute lag auf dem Küchenfenster.In Reichweite. Immer wenn Louis, Lucki, Hans und ich uns unter dem Tisch mit den Füßen neckten, machte er kurzen Prozess. Patsch. Die Rute prasselte auf uns nieder. Täter und Opfer wurden gleichermaßen bestraft. Wir nahmen die Schläge in Kauf. Unsere gemeinsame Zeit am Mittagstisch stellte eine wohltuende Auszeit unseres harten Alltags dar. Unser Leben bestand aus Arbeit. Schon als Sechsjähriger begann der Tag für mich morgens um 5 Uhr. Schweine füttern, Ställe ausmisten oder Schafe zum Wasserbrunnen führen. Um kurz nach acht ging es in die Schule, nach dem Mittagessen zur Feldarbeit. Gehorsam und Fleiß waren über jeden Zweifel erhaben.
Kirchturmkatzen und Besenstilochse
Und dann gab es immer wieder die Momente, in denen wir Kind sein durften und alles um uns herum vergaßen. Leider auch die Kühe, die wir an einem Sonntagmorgen beaufsichtigen sollten. Wir bastelten lieber an unserer Baumhütte. Mein Vater, meine Tante und mein Schwager besuchten die Messe in der Pfarrkirche und staunten nicht schlecht, als unser Vieh genüsslich die Blumen am Friedhof anknabberte. Das Urteil war gnadenlos: Schläge und Kellerverlies. Die drastischen Strafen konnten unsere Abenteuerlust nicht bremsen. Nach den Schularbeiten zogen wir mit Steinschleudern bewaffnet durch das Dorf. Wagemutig und voller Flausen im Kopf. Michel von Lönneberga in fünffacher Ausfertigung: Meine Brüder Lucki und Louis und die Nachbarsjungen Franz und Gerhard. An einem Nachmittag wollten wir den weisen Worten unseres Schuldirektors einen Selbstversuch folgen lassen. Unser Schulleiter war gleichzeitg Bezirksaufsichtsjäger. In den ersten beiden Stunden des Schulalltages erzählte er uns blumig aus der Welt der Tiere und Pflanzen. Wildkatzen können auf zwanzig Meter hohe Bäume klettern und landen trotzdem immer auf allen Vieren, behauptete der Jäger, was in unseren Ohren unvorstellbar klang. Das war für uns ein gefundenes Fressen. Da es uns unmöglich erschien, auf die Schnelle Wildkatzen aufzutreiben, packten wir die Katzen von unserem Hof in einen Jutesack und rannten zur Kirche. Mit vor Aufregung zitternden Händen öffneten wir die Tür. Den Schlüssel hatten wir ohnehin, da jeder im Dorf schon als Sechsjähriger zum Messdienerdienst verdammt wurde. Wir liefen die Treppe zum Glockenturm hoch, an dessen Ende sich ein großer Zwiebelhelm befand, der bis heute das Markenzeichen Obermillstatts darstellt. Oben angekommen entleerten wir den Jutesack und schmissen die Vierbeiner unterhalb der Kuppel aus den Fenstern. Zwanzig Meter oberhhalb der Friedhofsgräber, die sinnbildlich zur letzten Ruhestätte der verängstigsten und kreischenden Katzen zu werden drohten. Das geschickte Ausbalancieren mit dem Schwanz konnte zwar den dumpfen Knall beim Aufprall nicht verhindern, sorgte aber wie vorausgesagt für eine saubere Landung auf den Beinen. Bravo. Die Katzen zischten unter lautem Protest über die Friedshofsmauer von dannen. Nur der Hahn, den wir als Zugabe in den Sack gepackt hatten, war noch ein bis zwei Tage traumatisiert.
Das war nicht das einzige Mal, dass wir die Belastbarkeit der Tiere auf eine harte Probe stellten. Dem trägen Mastochsen im Stall wollten wir wieder Leben einhauchen, indem wir ihm einen Besenstiel in den Allerwertesten schoben. Er stand auf, wir flüchteten vor dem Koloss. Mein Vater war wohlwollend ausgedrückt, leicht irritiert, als er am Abend in den Stall kam, um das Vieh zu füttern. Der Tierarzt konnte das Gehölz ordnungsgemäß entfernen. Der Ochse blieb unverletzt.
Weltungergang in Kärnten
Niemals werde ich den 31. Juli 1958 vergessen. Jenen Tag, der mein Leben verändern sollte. Es war mittags, als in Obermillstatt faustdicke Hagelkörner auf die Felder und Höfe krachten, während sich die Menschen in den tiefergelegenen Dörfern noch sorglos sonnten. Wir rannten zur Pfarrkirche und läuteten die Glocken in der absurden Vorstellung, die Schallwellen könnten den sinflutartigen Niederschlag vertreiben. Gegen Abend kehrten wir zum Hof zurück. Meine ganze Familie kniete auf den Lerchendielen um den Küchentisch. Die Hände gefaltet, den flehenden Gebeten meiner Mutter lauschend. Stundenlang. Die Menschen auf dem Dach des Gasthofes Unterlercher in Lammersdorf beteten nicht. Sie schrien. Um ihr Leben. Um Hilfe. Ihre markerschütternden Schreie brannten sich unwiderruflich in das Bewusstsein eines neunjährigen Jungen. In mein Bewusstsein. Niemals werde ich die Panik in ihren Stimmen vergessen. Sie waren auf das Dach des Gasthofes geklettert, nachdem das Erdgeschoss durch Geröll völlig verwüstet war und unterspülte Felsbrocken gegen die höhergelegenen Balkone knallten. Ihre Schreie waren nutzlos. Die Verbindungsbrücken ins Tal nach Lammersorf und Pesenthein waren zerstört. Meine Großmutter vermutete den Weltuntergang. Im Oberlauf der Schlucht stauten sich die Wassermassen hinter Bäumen und Steinen. Die Naturgewalt war stärker. Wir schrien und weinten, die Erde bebte. Der Tod hatte kein Gesicht. Es war stockdunkel. Nur das bollernde Getöse in den Schluchten kündigte die verheerende Schlammlawine an. Dreizehn Autos wurden in den Millstätter See gespült. Zelte des vollbesetzten Campingplatzes in Pesenthein verschwanden in den Untiefen des Gewässers. Der Pesentheiner Bach trat über die Ufer und riss einen Arbeiter in den Tod. Sieben Menschen starben. Am nächsten Morgen errichtete die Feuerwehr provisorische Brücken aus Baumstämmen, Pioniere der Armee rückten an und suchten nach Verschütteten unter dem meterhohen Steingeröll. Zusammen mit Lucki und Franz bot sich mir ein Bild des Grauens: Von den Wassermassen aufgeblähte Schweine und Kühe.
Militärzeit: Zum Rapport mit Krawatte

Dienen fürs Vaterland: Rudi (links) genießt mit seinen Kamerade die Kärtner Sonne
Nach Abschluss der achten Klasse musste ich ein Jahr auf dem Hof arbeiten, bevor ich 1964 eine Lehre bei dem Bauunternehmer Ortner antrat. Nur neun Monate nach meiner Gesellenprüfung bestand ich die Aufnahmeprüfung für Bautechniker im benachbarten Villach am Wirtschaftsförderungsinstitut. Schon damals war ich getrieben von der Idee, mich immer weiter entwickeln zu müssen. Fürs Erste wurden meine Pläne jäh gestoppt. Die Schulausbildung in Villach sollte 4000 DM pro Jahr kosten. Zuschüsse gab es nicht und mein Vater ließ sich nicht erweichen. „Zur Schule kannst du später noch gehen.“ Viel später, wie sich im Nachhinein heraustellen sollte. 1968 musste ich zum Militär in die Landeshauptstadt Klagenfurt. Der Grundausbildung bei der Artillerie folgte der Einsatz bei der Stabskompanie. In dieser Zeit machte ich auch meinen LKW-Führerschein, brachte als Standortfahrer junge Soldaten zu Schießübungen oder Unteroffiziere zu Sprengkursen. Später war ich der persönliche Assistent des Oberst. Ich brühte ihm morgens den Kaffee auf oder brachte ihn zu Partys der Admiräle. Das war eine schöne Zeit, fernab der zermürbenden Hofarbeit. Mein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn war Segen und Fluch zugleich. Fluchen war auch die Spezialität von meinem vorgesetzten Fahrschulleher bei der Bundeswehr. Der Wachtmeister, ein schnurrbärtiger Giftzwerg aus dem Lavantal in Südkärnten, erniedrigte einen Bauernsohn aus dem Gailtal bei jeder sich bietenden Möglichkeit. Grundlos und gnadenlos. Aus Angst vor dem Kompaniechef ertrug der Junge die Erniedrigungen des Wachtmeisters. Ein Wachtmeister, der zuvor als einfacher Hofknecht gearbeitet hatte, wie mir ein befreundeter Unteroffizier steckte. Die Lavantaler galten im Kärtner Volksmund als Säufer, Südkärnten war die Hochburg der Schnapsproduktion. Vor der Universität in Klagenfurt ordnete der Fahrschullehrer einen Fahrerwechsel an, nicht ohne den Bauernsohn vor hunderten Schaulustigen runterzuputzen. Da platze mir endgültig der Kragen. „Weißt du was, du bist ein besoffener Mostschädel“, schleuderte ich meinem Vorgesetzten entgegen. Der war sprachlos, ich noch nicht. „Mach den Jungen nicht so fertig. Beim nächsten Mal hältst du die Fresse.“ Ich war nicht wirklich überrascht, als mich der Unteroffizier vom Dienst nach unserer Rückkehr in die Kaserne lautstark tadelte. „Oberzaucher, fertigmachen zum Bataillonsrapport in erster Garnitur“, hallte es während der Mittagsruhe über den Flur. Ich erhob mich vom Bett in unserer Stube, band mir die Krawatte um und ging zum Exerzierplatz, auf dem wir morgens marschierten und Sport trieben. Unsere ganze Kompanie stellte sich auf. „Oberzaucher vortreten“, befahl der Offizier. Ich trat vor. Mir wurde mein Fehlverhalten vorgelesen, meine Darstellung der Ereignisse interessierte niemanden, gehörte aber wohl zum vorgeschriebenen Prozedere. Am Ende verlas der Oberst das Urteil: Drei Monate Begünstigungssperre. Urlaub und freie Wochenenden wurden gestrichen und befödern wollten sie mich auch nicht mehr. Im Krieg hätten sie mich dafür erschossen, dessen war ich mir bewusst. Trotzdem kamen keine Worte des Bedauerns über meine Lippen. Auch mit dem Abstand von mittlerweile 45 Jahren hätte ich heute genauso gehandelt.
Der verlorene Sohn
Zum endgültigen Bruch mit meinem Vater kam es Weihnachten 1969. Mein Vater hatte mich für die Feiertage zum Stalldienst verdonnert. Louis, Franz und Luki blieben verschont. Wir lagen in unseren Betten, deren Säcke mit Haferstroh oder Maisfedern gefüllt waren. Und dennoch kroch die Kälte in dem unbeheizten Zimmer in unsere Glieder. So sehr, dass ich mich mit Luki in einem Bett aneinanderkuschelte. Am zweiten Weihnachtstag hatten wir bis tief in die Nacht gefeiert. Um 4.30 Uhr kam unser Vater ins Zimmer. „Rudi aufstehen zum Stalldienst“, befahl er. „Heute sind die anderen mal dran“, erwiderte ich und blieb liegen. Fünf Minuten später kehrte er zurück. „Aufstehen“, rief er energischer. Ich blieb eisern, nichts ahnend, was mich im nächsten Moment erwarten sollte. „Heute nicht.“ Dann kippte er einen Eimer Wasser über mich und erhob drohend seine Hand. Ich sprang auf, wir standen uns gegenüber. Ich blickte ihm in die Augen. „Wenn du jetzt zuschlägst, bekommst du es voll zurück. Ich bin 20 Jahre alt, das lass ich mir nicht mehr bieten. Du hast lange genug geschlagen. Jetzt ist Schluss.“ Der Unterkiefer meines Vaters bebte, er schmiss mir meine Militärtasche vor die Füße. „Du verlässt sofort den Hof. Lass dich hier nie wieder blicken.“ Ich packte meine Tasche und ging zum Hof meines besten Kumpels Franz Auer. Seine Eltern besaßen eine Sommerresidenz, in denen in der Feriensaison Urlauber untergebracht waren. Fast jeden Tag kam meine kleine Schwester Maria angelaufen.

Rudi in edlem Zwirn gehüllt als Zaungast vor einer Wanderhütte in Obermillstatt
Im Auftrag meiner Mutter. Die Botschaft war eindeutig. Junge, komm zurück! Meine Mutter war der ruhende Pol der Familie, die gute Seele. Und trotzdem ließ ich mich nicht erweichen. Ganz im Gegenteil: Franz und ich schmiedeten Zukunftspläne. Wir wollten ausbrechen. Wir wollten ein großes Abenteuer. Wir wollten in die Welt hinaus. Zwei Monate nach meiner Rebellion am Hofe standen wir morgens um 8.15 Uhr am Bahnhof in Spittal. Die Eltern von Franz versuchten noch uns umzustimmen. Sie warfen mir vor, ich würde ihren Sohn ins Verderben führen. Aber was hatten wir denn zu verlieren? Mein ganzes Leben passte in eine Tasche: 170 Mark, Gesellenbrief, Arbeitskleidung und ein paar frische Hemden.
Der Hauptbahnhof in München veränderte alles. Das war eine ganz andere Welt. Fasziniert von dem Treiben, abgestoßen von den besoffenen Obdachlosen, die wie Zombies zusammenkauerten. Ich traute meinen Augen nicht. Mitten in der Stadt fuhren Züge. „Das sind Straßenbahnen“, korrigierte mich Franz. Wir kauften am Kiosk eine Zeitung und forsteten die Stellenanzeigen durch. Die Leonhard Moll KG suchte Zimmerleute und Maurer. Der Bürokomplex des Bauunternehmes war nur 1500 Meter entfernt. Wir stiegen aus dem Taxi und gingen in das Personalbüro in den fünften Stock. Jugoslawen, Portugiesen und Italiener standen in einer Schlange. „Hey Buben, wo kommt ihr denn her?“, fragte der Abteilungsleiter und orderte uns per Handzeichzen nach vorne. „Habts gültige Papiere dabei?“ Wir zeigten ihm unsere Gesellenbriefe und Zeugnisse. „Ist ja wunderbar. Ihr könnt heute noch schaffen gehen.“
Die Untersuchung beim Betriebsarzt war ein echter Schock. Die Urinprobe war unauffällig, die Blutwerte waren gut. Und trotzdem ließen die Worte des Arztes das Blut in meinen Adern gefrieren. „Herr Oberzaucher, wären Sie dreißig Jahre früher geboren, hätten sie bei den Nazis ja richtig Karriere machen können.“ Ich war perplex. „Wie kommen Sie darauf?“ „Sie sind am 20. April geboren. Genau wie der Führer.“ Ich musste schlucken. Dass wusste ich nicht. Meine Eltern hatten mir das verschwiegen. 21 Jahre lang.